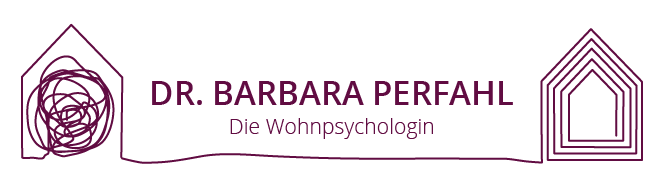Enquete des Bundesrates
Planung für Wohnen im Alter
Ich hatte am 09. April diesen Jahres die Ehre bei der Bundesrats-Enquete „Miteinander wachsen – Brücken der Generationen“ im österreichischen Parlament ein Referat zum Thema „Wohnpsychologie: Planen für Wohnen im Alter“ zu halten. Es ging um die Frage, wie die Wohnsituation von Menschen über 65 in Österreich aussieht, welche Probleme damit einhergehen, und wie man aus Sicht der Wohnpsychologie das Thema angehen sollte.
die komplette Enquete wurde live im Fernsehen übertragen und ein Mitschnitt ist auf youtube abrufbar:
Planung für das Wohnen im Alter (Protokoll)
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Vizepräsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich darf Ihnen heute ein paar Gedanken zum Thema Wohnen im Alter präsentieren, und zwar aus wohnpsychologischer Perspektive.
Damit Sie meinen Beitrag ein bisschen besser fachlich einordnen können, möchte ich gern eingangs ein paar Worte zum Thema Wohnpsychologie sagen, denn erfahrungsgemäß ist dieser Begriff nicht sehr bekannt. Die Wohnpsychologie oder, etwas weiter gefasst, die Architekturpsychologie ist ein wissenschaftliches Fachgebiet innerhalb der Psychologie, das sich bereits seit ungefähr Mitte der 1970er-Jahre mit dem wechselseitigen Verhältnis zwischen dem Menschen und seiner gebauten Umwelt befasst. Das Schöne an der Wohnpsychologie ist, die Erkenntnisse aus den Studien und aus der Forschung sind sehr direkt und mit einem großen Nutzen in die Praxis übertragbar.
Die Wohnpsychologie befasst sich im Grunde mit zwei Kernfragen – wenn man das so ein bisschen einschmilzt –, nämlich mit der Frage: Wie wirken Räume auf den Menschen und wie kann man im Umkehrschluss optimale Räume gestalten? Und die zweite Frage ist: Was braucht das Individuum zum glücklichen Wohnen?
Daraus ergeben sich jetzt allerlei Themen rund ums Thema Wohnen und Raumgestaltung, immer aus der Perspektive des Menschen, und natürlich dann auch ganz speziell Fragen zum Wohnen in bestimmten Lebensabschnitten, bei bestimmten Lebensaufgaben und mit den zugehörigen Wohnbedürfnissen, die sich daraus ergeben.
Wohnen im Alter ist jedenfalls ein Thema, mit dem sich die Wohnpsychologie eingehend befasst, weil sich halt die Anforderungen ans Wohnen über diese verschiedenen Lebensphasen zum Teil drastisch ändern.
Gleichzeitig ist Wohnen für den Einzelnen ein ganz, ganz wichtiger Teil seiner Lebensqualität und seiner Lebenszufriedenheit. Unsere Wohnung ist ja Basis für unser tägliches Leben, sie ist Ausgangspunkt für alle unsere Aktivitäten. Sie ist aber gleichzeitig auch der Ort, wohin wir uns zurückziehen, wo wir uns erholen, wo wir Kräfte sammeln können.
So gesehen sind das Wohnen, unsere Wohnung und unsere Wohnzufriedenheit ein ganz wichtiger Faktor für die Gesundheit. Also man kann sagen, für die Lebensqualität ist ein zufriedenes, den eigenen Bedürfnissen angemessenes Wohnen elementar.
Jetzt ist die Frage: Wie wohnen denn eigentlich Menschen im Alter oder im hohen Alter in Österreich? – Wenn man sich die Zahlen anschaut, kann man sagen: Sie wohnen überdurchschnittlich oft allein, auf überdurchschnittlich großer Wohnfläche und überdurchschnittlich oft in einem Einfamilienhaus. Um nur eine Zahl von vielen, die es gibt, zu nennen: Der durchschnittliche Einpersonenhaushalt von einem Menschen über 64 Jahre hat im Durchschnitt 85 Quadratmeter.
Das heißt, es ist eigentlich eine sehr komfortable Wohnsituation. Gleichzeitig bringt aber das Alter bestimmte Anforderungen mit sich. Das entsteht aus zwei Bereichen: zum einen aus familiären Veränderungen – die Kinder sind aus dem Haus, der Partner wird häufig verloren, entweder durch Scheidung oder durch Tod –, und zum anderen gibt es körperliche Veränderungen im Alter, die dann für die allermeisten irgendwann auch körperliche Einschränkungen heißen.
Diese Art des Wohnens führt in Kombination mit diesen Veränderungen zu Problemen beim Wohnen. Das geht los, wenn oftmals die Wohnung oder das Haus subjektiv als zu groß empfunden wird. Es werden dann zum Teil Räume oder in Einfamilienhäusern ganze Etagen nicht bewohnt.
Es kommt irgendwann zu einer Überforderung mit den Aufgaben in Haus und Garten. Der Haushalt kann nicht mehr so bewältigt werden, wie man das gern möchte.
Es gibt das Problem der Leistbarkeit. In der Pension wird ein deutlich höherer Anteil vom Einkommen für das Wohnen verwendet. Manchmal werden die Wohnungen einfach gar nicht mehr leistbar.
Es gibt auch das Thema Barrierefreiheit. Viele dieser Wohnungen und Häuser sind nicht barrierefrei, und es ist oftmals auch gar nicht klar, ob die Pflege, wenn sie dann notwendig ist, dort auch im notwendigen Ausmaß leistbar und möglich ist.
Es gibt auf dem Land auch noch das Thema der langen Wege. Wenn Wohnungen, Häuser nur mit dem Auto erreichbar sind und das Auto als Transportmittel wegfällt, führt das nicht selten zur Reduktion der sozialen Anbindungen bis hin zur Vereinsamung. Frau Präsidentin Korosec hat aber natürlich recht: Das Thema Vereinsamung ist auch ein Stadtthema.
Also wir haben dann ab einem bestimmten Punkt hohe Wohnbelastungen, oder zumindest passt die Wohnsituation nicht mehr zu den Bedürfnissen und den Anforderungen.
Was wäre der logische Schritt? – Der logische Schritt wäre eine Veränderung dieser Wohnsituation. Das könnte ein Umzug in eine kleinere, barrierefreie, günstigere Wohnung sein. Das kann aber auch sein: der Umbau oder die Anpassung der vorhandenen Räume mit einer altersgerechten Ausstattung.
Es gibt inzwischen vielfältige Möglichkeiten. Es gibt bauliche Möglichkeiten, technische Möglichkeiten, es gibt vor allem aber ganz viele Modelle, wie Wohnen anders aussehen kann, angefangen damit, dass das Einfamilienhaus in zwei Wohneinheiten aufgeteilt wird und man sich jemand anderen dazuholt. Es gibt das Modell Hilfe für Wohnen, wo zum Beispiel ein Student zu einem älteren Menschen zieht, dort mithilft und dafür dort wohnen kann. Damit entsteht dieser Generationenkontakt, der ja an anderer Stelle vermisst wird. Es gibt Mehrgenerationenwohnungen auch in der Familie. Es gibt gemeinschaftliche Wohnformen, alles Mögliche. Also da gäbe es viel Auswahl und viele Möglichkeiten.
Die Erfahrung ist aber, dass es bei den Betroffenen ganz große Widerstände gegen Veränderung gibt und sie sich überhaupt erst ganz spät mit Thema beschäftigen. Die meisten Menschen fangen erst ungefähr mit 75 oder 80 Jahren an, über dieses Thema nachzudenken; und zwar dann, wenn schon wirklich Probleme da sind. Wenn es dann Veränderungen in der Wohnsituation gibt, dann sind die gar nicht selten erzwungen. Man muss quasi von heute auf morgen raus aus der Wohnung, und das ist, muss man sagen, bis hin zu traumatisch für die Betroffenen, zumindest ist es aber eine deutliche Einschränkung und Beeinträchtigung der Zufriedenheit und der Lebensqualität.
Das heißt, obwohl natürlich jedem eigentlich bewusst ist, dass man selber und seine Bedürfnisse sich mit dem Alter verändern, wird das Thema Wohnen in dem Zusammenhang überhaupt nicht angeschaut, und spannenderweise sind auch finanzielle Anreize oft kein ausreichender Anreiz, dass sich etwas verändert.
Jetzt stellt sich natürlich aus wohnpsychologischer Sicht die Frage: Warum ist das so? Was sind die Gründe dafür, dass es da so große Widerstände gibt? Es gibt ein paar Konzepte in der Wohnpsychologie, die erklären können, warum bei den Personen einfach große Probleme oder Widerstände vorhanden sind, sich mit dem Thema zu befassen.
Vorwegschicken muss man in dem Zusammenhang, dass Räume immer affektive Räume sind. Das heißt, jeder Raum, in den wir reinkommen, löst bei uns Emotionen aus. Das kann positiv sein oder negativ, das kann sehr stark sein oder ganz schwach, sodass es uns gar nicht bewusst wird.
Die eigenen Wohnräume sind in der Regel sehr positiv besetzt, und das liegt an den psychologischen Mechanismen, die in diesem Zusammenspiel Mensch und Wohnraum greifen. Der zentrale Mechanismus, den es da gibt, ist die sogenannte Aneignung. Wir Menschen haben die ganz grundsätzliche Tendenz, uns unsere Umgebung zu eigen zu machen, sie an unsere Bedürfnisse anzupassen und zu gestalten. Das ist gerade für Wohnräume zentral. Aneignung ist der Prozess, der aus irgendwelchen Räumen meine persönlichen Wohnräume werden oder aus irgendeinem Haus mein Zuhause werden lässt.
Das heißt, ich richte die Räume nach meinem Geschmack ein, ich schaffe persönliche Bezüge, und ich bewohne und nutze sie nach meinen Bedürfnissen. Die Erfüllung dieser Wohnbedürfnisse – das sind mehrere, so etwas wie Sicherheit, Erholung, Gemeinschaft, aber auch Gestalten oder ästhetische Bedürfnisse – ist wiederum zentral für die Wohnzufriedenheit. Wenn die Aneignung gelingt, dann fühle ich mich wohl in meinen Räumen, und, das ist der entscheidende Punkt, ich binde mich an sie.
Dazu gibt es ein weiteres Phänomen, die sogenannte Ortsbindung. Je länger wir an bestimmten Orten verweilen, desto stärker binden wir uns emotional daran. Wenn jemand 30 Jahre in der gleichen Wohnung gelebt hat, ist er emotional total daran gebunden.
Das geht aber noch einen Schritt weiter. Diese Bindung, muss man sagen, ist ja fast eine Verzahnung, es gibt nämlich darüber hinaus auch das Phänomen der Ortsidentität. Das besagt, kurz gesagt, dass die Räume, unsere Wohnräume, Teil unserer Ich-Identität werden. Die Ich-Identität ist nämlich zum großen Teil aus Erinnerungen an Erlebnisse der Lebensspanne zusammengesetzt, und Erinnerungen sind immer ortsgebunden, denn die Erlebnisse haben immer irgendwo stattgefunden. Das heißt, Orte, an denen ich sehr viel oder sehr wichtige Dinge erlebt habe, baue ich quasi in meine Ich-Identität ein. Die werden, wenn man so möchte, Teil von mir selber. Deshalb können Räume auch Repräsentanten für Lebensabschnitte werden. Also mein Zuhause ist Stellvertreter für mein ganzes Leben oder einen Teil davon.
Dann haben wir noch ein viertes Phänomen, das Änderungen häufig entgegensteht, und das ist das sogenannte Wohnzufriedenheitsparadoxon. Man hat nämlich festgestellt, wenn man Menschen befragt, wie zufrieden sie mit ihrer Wohnsituation sind, dass sie, wenn es da gravierende Probleme gibt, diese oft ausblenden. Der Klassiker ist die Befragung der Menschen, die in der Frankfurter Einflugschneise wohnen. Wenn man die befragt, wie zufrieden sie sind, sagen sie: superzufrieden. Wenn man sagt: Ja, und was ist mit dem Lärm? – Ach ja, den Lärm gibt es auch. – Aber mit dem Wohnen sind sie sehr zufrieden. Das heißt, beim Zufriedenheitsurteil beim Wohnen werden Störungen oder Probleme oft ausgeblendet. Wenn ich aber erstmal subjektiv zufrieden bin, habe ich auch keinen Anreiz, etwas zu verändern.
Wenn man zusammenfassend auf diese Phänomene schaut, kann man sagen: Wohnräume sind identitätsstiftend. Wir sind eben emotional gebunden, und gerade für ältere und alte Menschen schaffen Wohnräume eine große Sicherheit: Mein Zuhause ist auch mein Sicherheitsanker in der Welt. Das erklärt natürlich, warum die Menschen starke Widerstände empfinden, irgendetwas zu verändern, und sich lange nicht damit befassen möchten. Es helfen die besten rationalen Argumente nichts, wenn die Emotion da ist.
Wie kann man jetzt damit umgehen und wie kann man dafür sorgen, dass Menschen im Alter glücklich, zufrieden und altersgerecht wohnen können und alle Wohnbedürfnisse, die sie dann haben, erfüllt sind? Aus wohnpsychologischer Sicht sind zwei Faktoren entscheidend: Zum einen ist es die frühzeitige Information für das rechtzeitige Planen. Ich bin wieder bei Frau Präsidentin Korosec: Die Planung, und zwar die frühzeitige, ist das Thema.
Wohnen im Alter muss ein Thema werden. Je früher sich die Menschen damit beschäftigen, desto besser. Ideal wäre eben ein Zeitpunkt ungefähr um die 60 Jahre, nicht zwingend für eine Veränderung, sondern für die Auseinandersetzung mit dem Thema. Es geht beim Istzustand los: Was ist mir denn jetzt wichtig beim Wohnen? Was sind jetzt meine Wohnbedürfnisse? Wie bin ich jetzt mit meinem Wohnen zufrieden? Was sind denn die Herausforderungen, die dann im Alter auf mich zukommen? Und was wären mögliche Lösungen dafür?
Wie gesagt, es gäbe genug. Es geht nicht immer darum, dass man aus den eigenen Räumen hinausgeht. Manchmal geht es nur um eine Anpassung der Räume. Aber es müssen Lösungen formuliert werden, und ideal wäre es, wenn man, ich sage einmal mit 65, einen Plan A, einen Plan B und einen Plan C hat. Je nachdem, was dann das Leben in den Jahren so bringt, hat man Möglichkeiten, sich dann zu verändern, und zwar nicht aus Zwang heraus von heute auf morgen, sondern man ist dann quasi emotional gewappnet. Das ist eigentlich der Punkt: Es geht um diese Auseinandersetzung mit dem emotionalen Prozess.
Eine Veränderung, gerade was das Wohnen betrifft, ist nämlich ein Prozess. Das ist nichts, was man innerhalb von drei Tagen macht, sondern da geht es genau um diese Auseinandersetzung mit dem Jetzt, mit dem Übergang und mit dem Morgen. Dann hat man nämlich auch (in Richtung Dr. Henning), wie Sie es in Ihrem Vortrag vorhin thematisiert haben, Kontrolle und Autonomie. Damit erhält man quasi seine Kontrolle und Autonomie, wenn man selber Pläne hat, wie man das dann machen kann.
Der zweite Punkt, der aus meiner Sicht wichtig wäre, sind konkrete Angebote zur Unterstützung, und zwar, wenn dann wirklich der Zeitpunkt zur Veränderung gekommen ist, dass man dann konkrete Unterstützung bei den behördlichen, technischen oder organisatorischen Themen hat. Wenn es zu einem Umzug kommt, muss auch der organisiert werden. Ein Umzug bedeutet für viele Leute eine logistische Herausforderung oder auch Überforderung.
Unterstützung kann man sich zum Beispiel in der Form vorstellen, dass jemand kommt, die Bücher aus dem Bücherregal in die Kiste packt und in der neuen Wohnung wieder auspackt; aber, und das ist natürlich mir als Psychologin ein besonderes Anliegen, vor allem sollte es auch eine emotionale Unterstützung und Begleitung bei diesem Prozess der Loslösung vom Alten und des Ankommens im Neuen geben. Wir haben Gott sei Dank in der Psychologie gute Möglichkeiten, Menschen bei solchen Veränderungsprozessen zu begleiten. Gerade die Wohnpsychologie könnte da eben einen guten Beitrag für die Beratung und Unterstützung sowohl der Betroffenen als auch der Institutionen leisten.
Dann könnte die Veränderung des Wohnens im Alter – und ich verwende jetzt die Formulierung von Herrn Dr. Henning – auch weniger ein Abschied und mehr eine Chance sein. – Vielen Dank.
Videos
Eine Aufzeichnung der gesamten Enquete findet man auf der Webseite des Parlaments